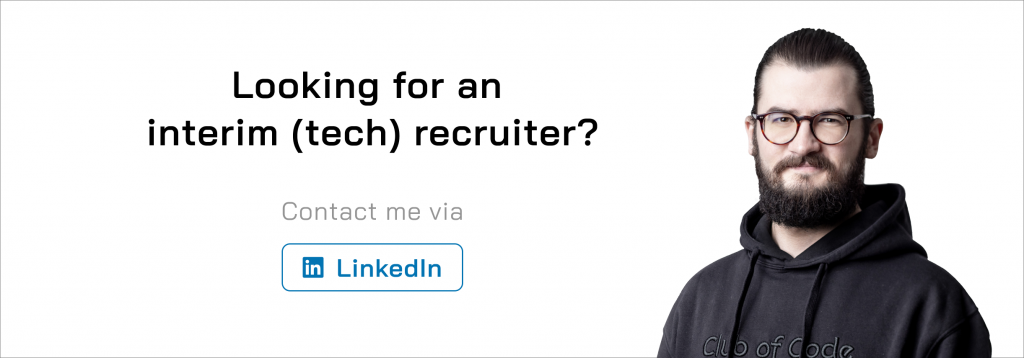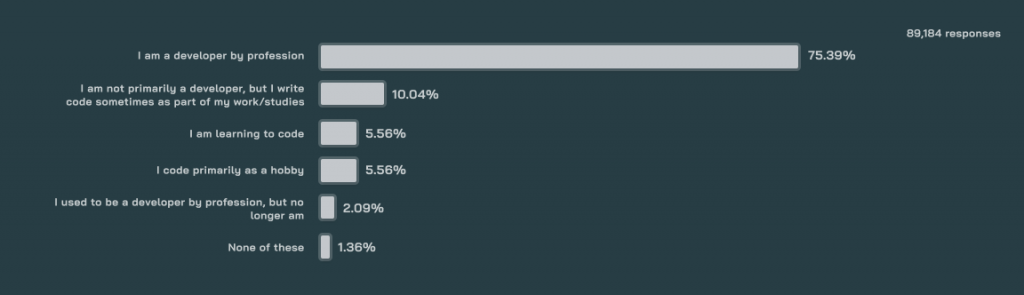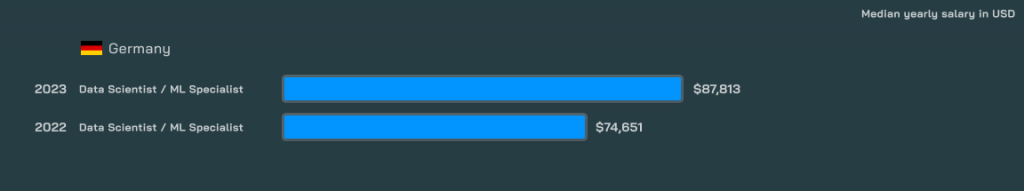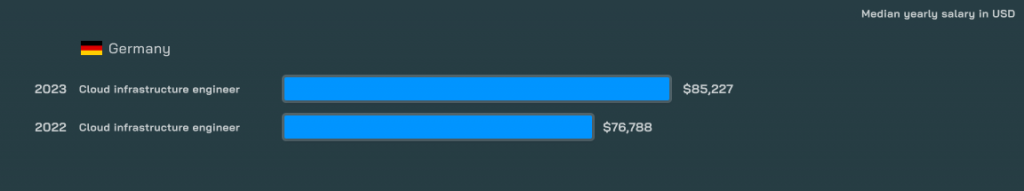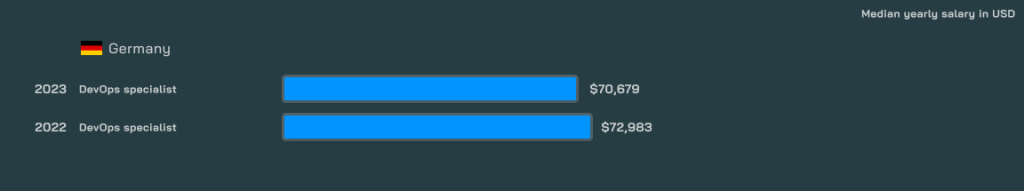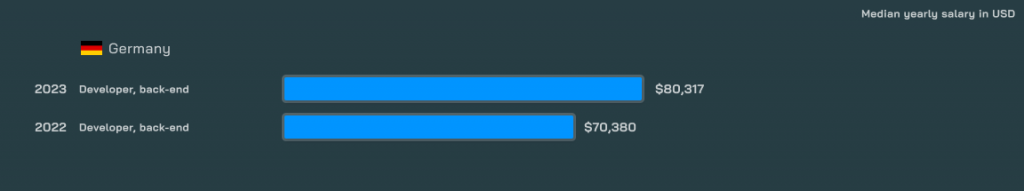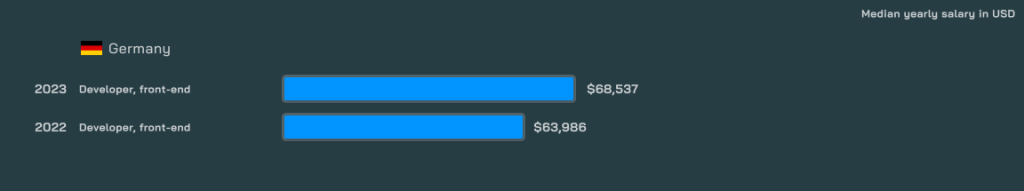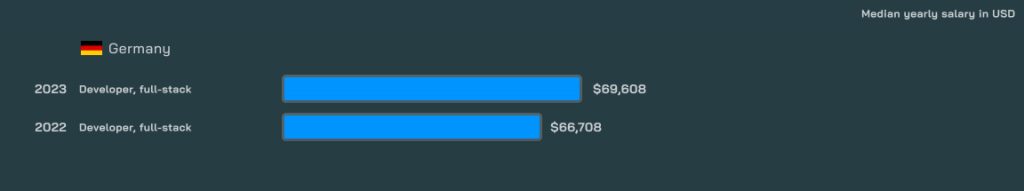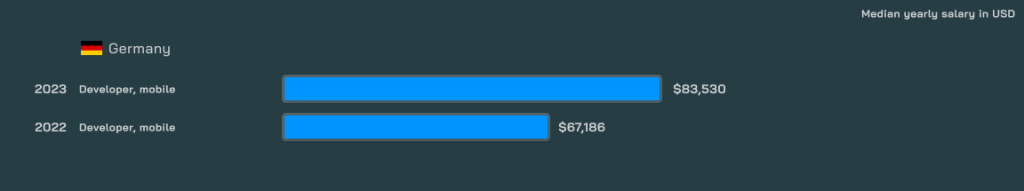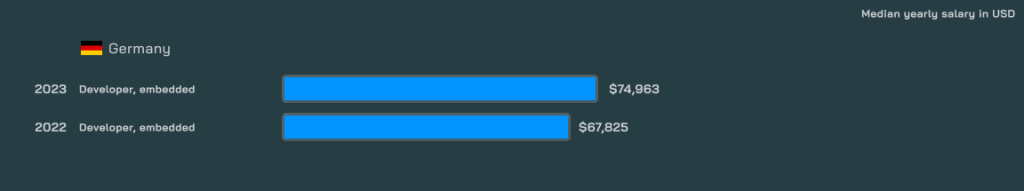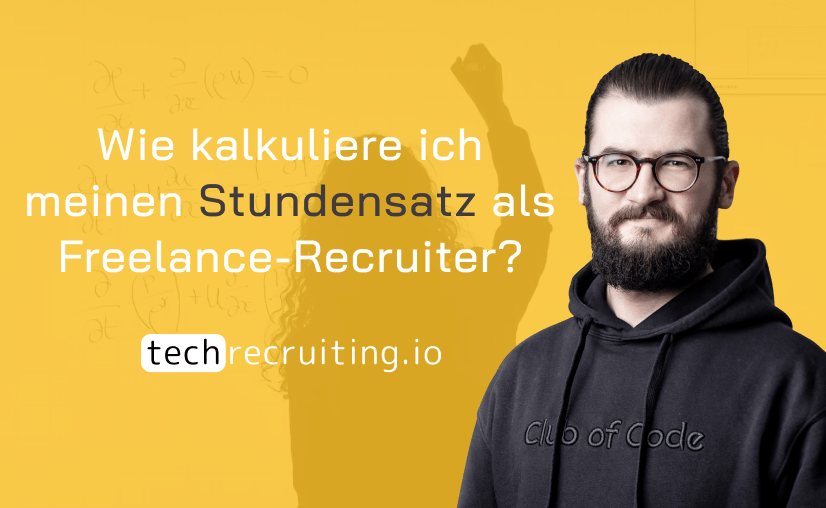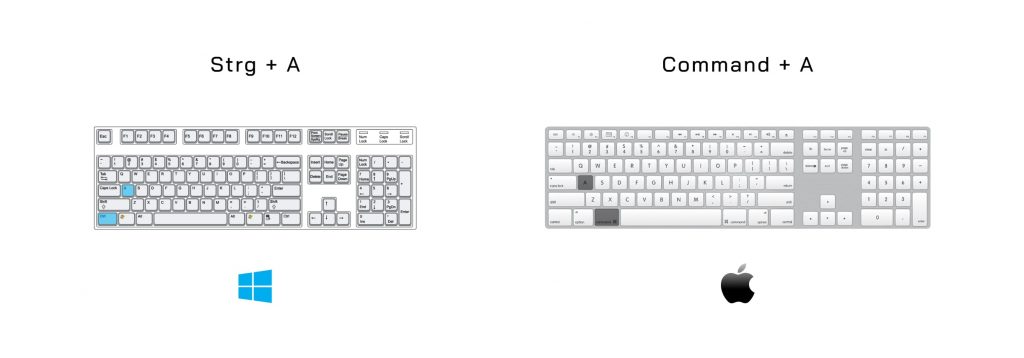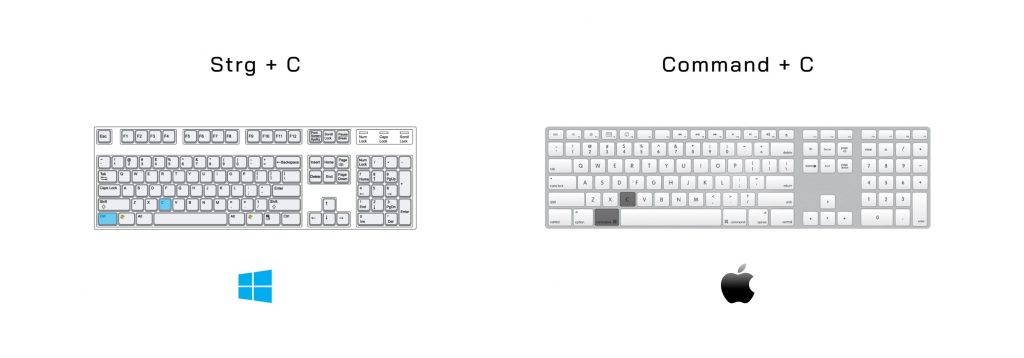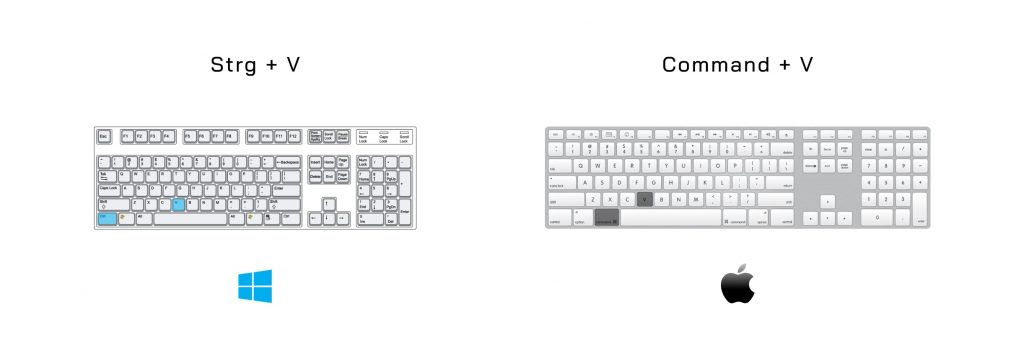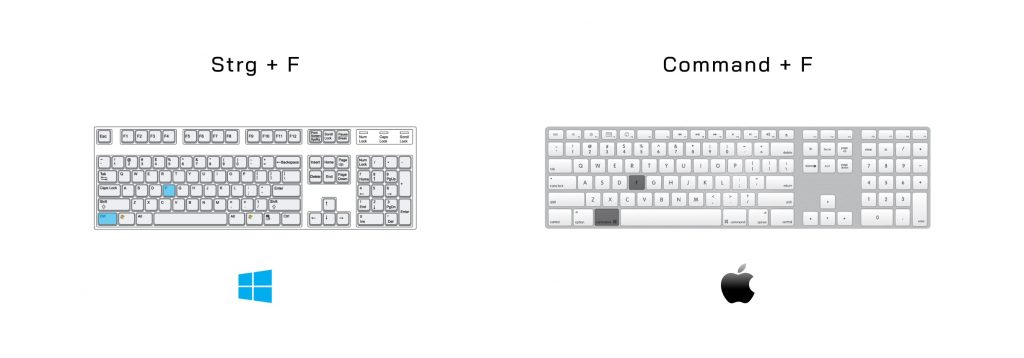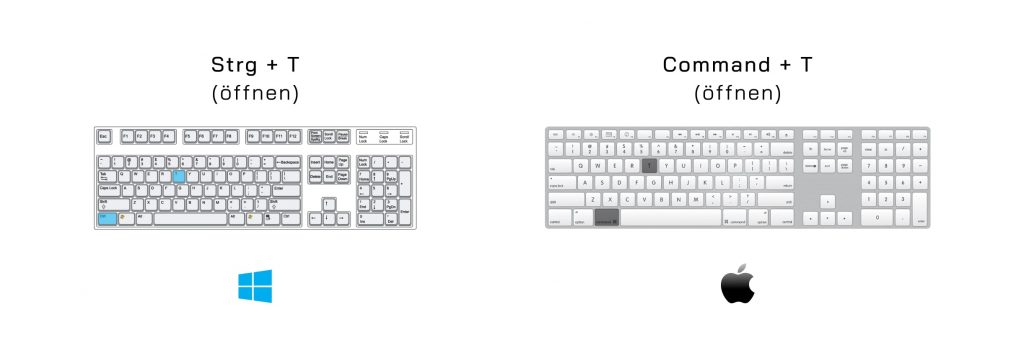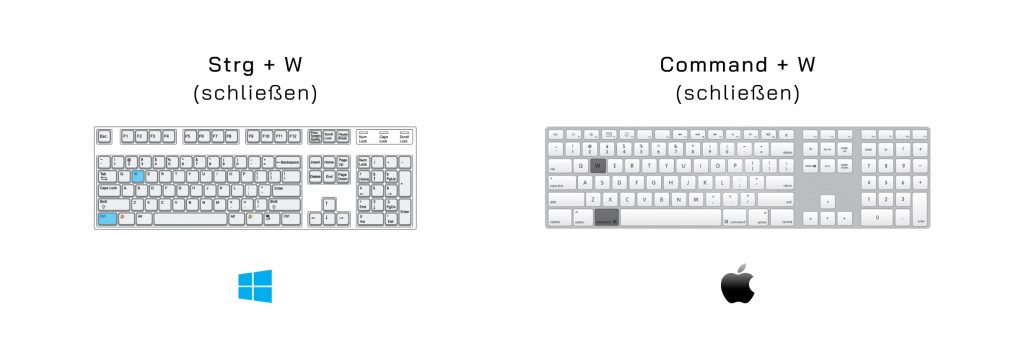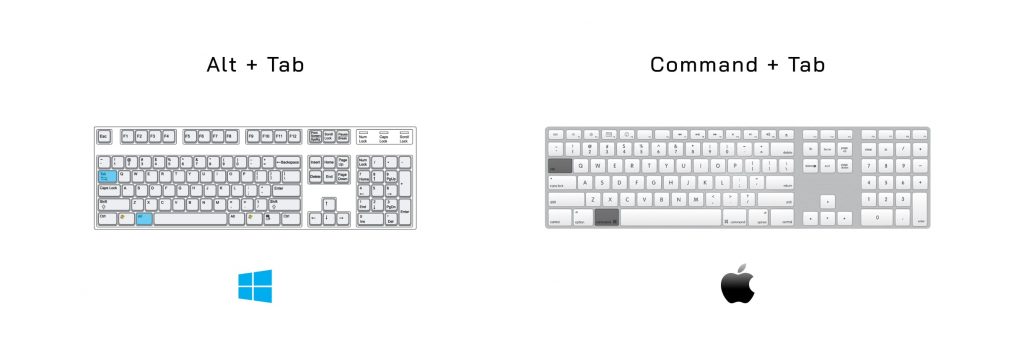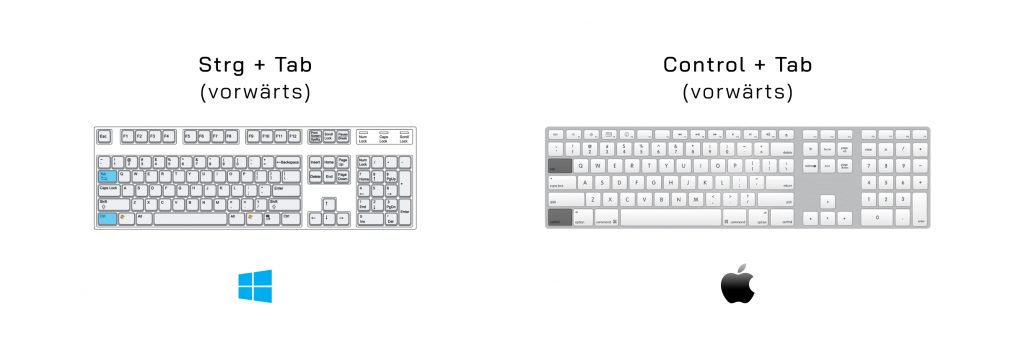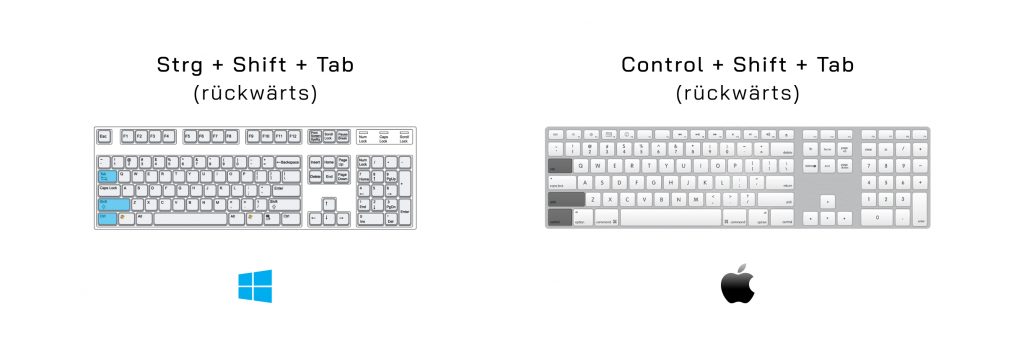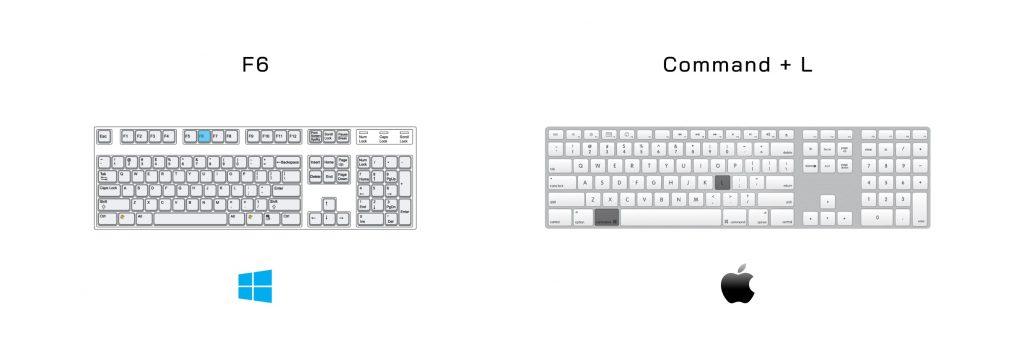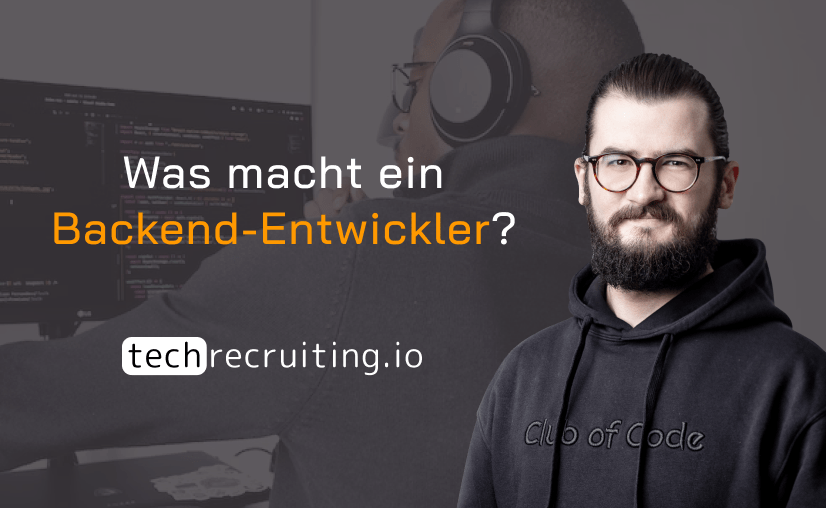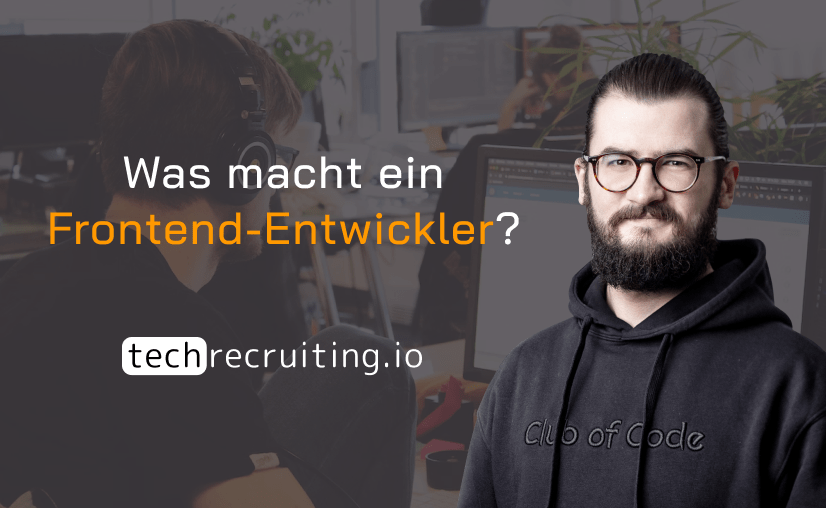Du bist Hiring Manager, suchst neue Mitarbeiter für dein Team und sollst nun mit deinem Recruiter zusammenarbeiten? Du weißt nicht so richtig, was auf dich zukommt oder was von dir erwartet wird? Dann lies dir diesen Artikel durch.
Candidate Persona: Wen suchst du überhaupt?
Das Wichtigste kommt zuerst: Am Anfang musst du dir klar machen, wen du überhaupt suchst (Candidate Persona). Noch bevor irgendein Jobtitel erwogen oder eine Stellenanzeige verfasst wird, ist diese Ausgangsfrage die alles entscheidende und bildet das Fundament für euren Recruiting-Erfolg. Denn die Beantwortung dieser Frage ist gar nicht so leicht.
Mach dir bewusst, was der potenziell neue Mitarbeiter eigentlich in deinem Team leisten soll. Führe dir dabei aber auch vor Augen, was eine Person realistisch in gegebener Arbeitszeit von ca. 40 Wochenarbeitsstunden leisten kann. Da draußen geistern bereits sehr viele Stellenanzeigen herum, die einen Fullstack-Entwickler suchen, der auch DevOps machen kann (und bestimmt noch den ein oder anderen Drucker reparieren soll). Tue dir selbst, eurem Recruiting-Erfolg und den potenziellen Bewerbern gegenüber den Gefallen und bleibe realistisch. Dabei kannst du dich mit folgenden Fragen auseinandersetzen:
- Wen suchst du genau?
- Was sind die absoluten Must-have-Kriterien? (Begrenze diese auf 3)
- Was ist Nice-to-have? Was könnte man ggf. in der Tätigkeit selbst lernen oder nachträglich schulen?
- Welche Priorisierung gibt es innerhalb dieser Kriterien?
- Wie stellst du dir das neue Teammitglied vor? Ist es ein Mann oder eine Frau? Wie alt ist sie oder er? Woher kommt sie oder er?
Die letzten Fragen verstoßen gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), sind jedoch trotzdem wichtig, um sich ein genaues Bild vor Augen zu führen. Dieses Bild ist wichtig, um es mit deinem zuständigen Recruiter, der dich bei der Suche nach dem neuen Teammitglied unterstützt, zu teilen. Wenn er versteht, was du suchst, seid ihr eurem Recruiting-Erfolg bereits einen großen Schritt entgegen gegangen.
Wichtig hierbei ist jedoch, dass du nicht auf der Candidate Persona bestehst. Der 100% passgenaue Kandidat ist selten so anzutreffen. Halte also auch hier deine Erwartungshaltung realistisch. Fokussiere dich bei potenziellen Kandidaten auf das, was dein Gegenüber mitbringt und nicht auf das, was ihm deiner Vorstellung nach fehlt.
Recruiting vs. Active Sourcing: Kenne den Unterschied
Du und dein Recruiter haben nun verstanden, wen genau ihr sucht. Dies ergibt, in Kombination mit den Aufgaben, die der potenzielle Mitarbeiter erledigen soll, bereits die Stellenanzeige. Achtet hierbei auf die gesetzlichen Bestimmungen wie die Einhaltung des AGG.
Im nächsten Schritt wird dein Recruiter Reichweite für eure Stellenanzeige generieren, um diese unter möglichst vielen Menschen zu streuen. Hierzu nutzt er bspw. Jobbörsen wie Stepstone oder Indeed. Dies ist das klassische Recruiting, wo Unternehmen sinngemäß darauf warten, dass sich jemand bewirbt. Hierbei kannst du deinen Recruiter insofern unterstützen, dass du und dein Team die Stellenanzeige in Social Media, wie bspw. LinkedIn, teilen oder in eurem Freundes- und Bekanntenkreis davon erzählen.
Doch gerade im Recruiting von Tech-Talenten, die sich zurzeit ihren Arbeitsplatz aussuchen können, benötigt es weitere Recruiting-Maßnahmen, um gute Leute zu finden und von sich zu überzeugen. Hier kommt das Active Sourcing ins Spiel. Active Sourcing ist die aktive Suche nach Kandidaten. Du hast sicher selbst bereits Nachrichten von Recruitern über LinkedIn erhalten, die dich zum Wechsel bewegen wollten. Dein Recruiter wird im Active Sourcing passende Profile über LinkedIn oder andere Plattformen suchen und diese kontaktieren. Hier trifft es sich wieder gut, dass ihr genau über die Candidate Persona und ihre Kriterien gesprochen habt. Ihr könnt auch gemeinsam überlegen, ob es Sinn macht, die gefundenen Profile über deinen LinkedIn-Account anzusprechen. Je näher der Anschreiber am Fachbereich ist, desto besser. Potenzielle Mitarbeiter möchten lieber direkt mit der Person oder einem Teammitglied sprechen, mit dem sie potenziell zusammenarbeiten, als mit einem Recruiter oder (noch schlechter) einem Externen, wie einem Personaldienstleister.
Aber warum ist der Unterschied zwischen Recruiting und Active Sourcing so wichtig?
Der Unterschied ist für dich als Hiring Manager wichtig zu verstehen, weil die Perspektive jeweils eine andere ist und damit einen eigenen Prozess erfordert. Im Recruiting bewirbt sich der Kandidat bei euch. Im Active Sourcing bewerbt ihr euch beim Kandidaten. Dies hat zur Folge, dass die Gespräche im Active-Sourcing-Prozess keine klassischen Bewerbungsgespräche, sondern vielmehr ein Kennenlernen sind. Führe dir vor Augen, dass du mit jemandem sprichst, der von euch kontaktiert wurde, in einem bestehenden Arbeitsverhältnis (ohne Not zu wechseln) ist und sich in eurem Gespräch mal anhört, was es noch für Möglichkeiten gibt. Dies ist eine andere Situation als wenn jemand aktiv auf Jobsuche ist.
Recruiting-Prozess kennen und mitgestalten
Du musst daher wissen und verstehen, auf welchem Weg die Kandidaten zu euch kommen. Es wäre nämlich ziemlich fatal, wenn deine erste Frage im Vorstellungsgespräch “Warum haben Sie sich bei uns beworben?” ist und der Kandidat nur entgegnen kann, dass “Sie mich doch kontaktiert haben…”. So schnell kann ein potenziell guter Kandidat abspringen.
Es ist daher wichtig, dass du weißt, woher der Kandidat kommt und den Recruiting-Prozess kennst. Wie viele Interviews führt ihr? Wann kommst du ins Spiel? Und was erwartet den Kandidaten als nächstes? Das sind alles Fragen, die du beantworten können musst. Und dies erreichst du am Besten, indem du den Recruiting-Prozess selbst mitgestaltest. Frage dich einfach: Welchen Prozess würdest du als Kandidat gerne durchlaufen? Was wäre dir wichtig?
Findest du es okay, wenn man sich auch 2 Wochen nach einem Gespräch nicht gemeldet hat? Oder wenn man sich gar nicht mehr meldet? Letztlich ticken wir Menschen da alle gleich. Wir haben Aufwand in Form einer Bewerbung, eines Bewerbungsgesprächs oder Telefoninterviews auf uns genommen und wollen direkt wissen, was daraus folgt. Und wenn wir wochenlang nichts hören, leidet nur das Ansehen des Gegenübers, in diesem Fall des Unternehmens. Bleibe daher empathisch und biete einen Prozess, der fair und angenehm für alle Beteiligten ist.
Setze dich hierzu mit deinem Recruiter zusammen und vereinbart Ziele. Wie lang soll der Prozess von Erstkontakt bis zur Einstellung dauern? Wann erhalten Kandidaten eine Zu- oder Absage (bis wann musst du dich entschieden haben)? Wer muss alles zustimmen, ob ein Angebot gemacht wird?
Tech-Recruiting für Hiring Manager: 5 Tipps & Tricks
Abschließend fasse ich dir noch 5 Tipps & Tricks zusammen, die deinen Recruiting-Erfolg fördern und dich im Prozess etwas entspannen lassen.
Tipp 1: Lasst euch nicht zu viel Zeit. Gute Kandidaten sind schnell vergriffen. Mache Recruiting daher für eine kurze Zeit zu deiner Top-Priorität mit klarem Fokus.
Tipp 2: Tausche dich 5 Minuten vor einem Gespräch mit deinem Recruiter aus, damit ihr mit dem gleichen Stand ins Gespräch geht.
Tipp 3: Setzt eure Gespräche für 10-nach (bspw. 13:10 Uhr) an, um pünktlich zu sein, euch vorher 5 Minuten abstimmen zu können und als Einheit in das Gespräch zu gehen (das wirkt seriös).
Tipp 4: Bleibe offen für neue Recruiting-Ideen. Wie wäre es bspw. mit einer Video-Nachricht an Kandidaten?
Tipp 5: Wenn dir das Gespräch mit einem Kandidaten gefallen hat, vernetze dich bei LinkedIn mit ihm oder ihr. Das zeigt einen positiven Impuls und ihr bleibt auch nach einer Absage in Kontakt. Vielleicht gibt es zu einem späteren Zeitpunkt ja ein Match.
Recruiting ist gar nicht so schwer. Bleib einfach bodenständig, empathisch und offen für den Input deines Recruiters. Erschaffe Prozesse, die du selbst gerne sehen möchtest und engagiere dich aktiv. Dann stellst du ein.

FAQ
Was macht ein Hiring Manager?
Ein Hiring Manager ist für gewöhnlich eine Führungskraft aus dem Fachbereich, in der ein neuer Mitarbeiter eingestellt werden soll. Er übernimmt damit die Verantwortung für die Einstellung des neuen Mitarbeiters aus Sicht des Fachbereichs und arbeitet mit der Recruiting-Abteilung zusammen.